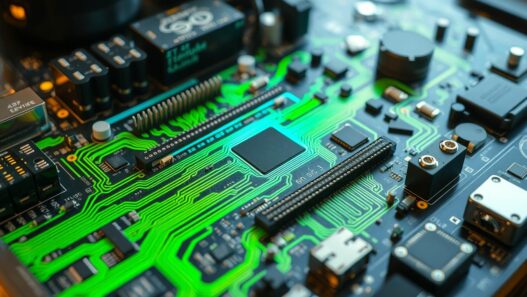Wussten Sie, dass die CropEnergies AG in Sachsen-Anhalt die größte Produktionsanlage für Bioethanol in Deutschland betreibt, die pro Jahr rund 700.000 Tonnen Weizen zu Biosprit verarbeitet? Diese beeindruckende Zahl zeigt das enorme Potenzial, das Biokraftstoffe bieten, um als erneuerbare Energien den Kraftstoffverbrauch nachhaltiger zu gestalten und die Umweltbelastung erheblich zu reduzieren. Dennoch steht die Nutzung von Biokraftstoffen auch stark in der Kritik, insbesondere wegen der Nahrungsmittelnutzung und der damit verbundenen Umweltauswirkungen.
Angesichts der Tatsache, dass Deutschland im Jahr 2023 insgesamt 51 Millionen Tonnen Benzin und Diesel verbrannte, wird das Potenzial von Biokraftstoffen als umweltfreundliche Treibstoffe deutlicher. Mit Treibhausgaseinsparungen von bis zu 65% bieten Biokraftstoffe eine effektive Möglichkeit, den CO2-Ausstoß zu verringern. Zudem sind sie wesentlich, um die Abhängigkeit von fossilen Brennstoffen zu reduzieren. Allerdings erfordert der Anbau der Anbaubiomasse riesige Flächen, was oft auf Kosten der Biodiversität und landwirtschaftlicher Nutzflächen geht. Daher ist ein ausgewogener Ansatz notwendig, um sowohl die Umwelt zu schützen als auch die Vorteile der Biokraftstoffe zu nutzen.
Wichtige Erkenntnisse
- Biokraftstoffe wie Bioethanol und Biodiesel bieten erhebliche Treibhausgaseinsparungen.
- Etwa 700.000 Tonnen Weizen werden jährlich in Deutschlands größter Produktionsanlage zu Bioethanol verarbeitet.
- Die Nutzung von Biokraftstoffen kann die Abhängigkeit von fossilen Brennstoffen reduzieren.
- Trotz der Vorteile steht die Nutzung von Nahrungsmitteln zur Treibstoffproduktion in der Kritik.
- Große Flächen sind für den Anbau von Biomasse erforderlich, was die Biodiversität beeinträchtigen kann.
Einführung in Biokraftstoffe
Biokraftstoffe sind Brennstoffe, die aus Biomasse gewonnen werden und in flüssiger oder gasförmiger Form zur Energiegewinnung dienen. Sie bieten eine vielversprechende Alternative zu fossilen Brennstoffen, insbesondere durch ihren Beitrag zur Reduktion von Treibhausgasemissionen und zur Förderung der ökologischen Nachhaltigkeit. Der Verkehrssektor, der zu einem Viertel der weltweiten direkten CO2-Emissionen aus der Kraftstoffverbrennung beiträgt, kann enorm von der Einführung und Nutzung von Biokraftstoffen profitieren.

Definition und Typen von Biokraftstoffen
Es gibt verschiedene Typen von Biokraftstoffen, wobei die bekanntesten Bioethanol und Biodiesel sind. Bioethanol wird oft aus zucker- und stärkehaltigen Pflanzen wie Mais und Weizen gewonnen. Es wird als E5 oder E10 im Ottokraftstoff verwendet, wobei der Anteil an Bioethanol bestimmte Prozentsätze nicht übersteigt. Biodiesel wird hauptsächlich aus Pflanzenölen wie Rapsöl hergestellt und kann bis zu sieben Prozent des Dieselkraftstoffs ausmachen. Darüber hinaus fördern fortgeschrittene Biokraftstoffe, die aus Abfall- und Reststoffen produziert werden, die Diversifizierung und Nachhaltigkeit der Energiequellen.
Historische Entwicklung und gesetzliche Regelungen
Die Entwicklung von Biokraftstoffen als alternative Energiequelle begann verstärkt in den letzten Jahrzehnten. Mit der Einführung der Biokraftstoffquote im Jahr 2007 in Deutschland wurde die gesetzliche Grundlage gelegt, um den Einsatz von Biokraftstoffen im Verkehrssektor zu erhöhen. Diese Quoten sind Teil umfassenderer gesetzlicher Regelungen, die darauf abzielen, die Treibhausgasemissionen bis 2030 um mindestens 13 % zu reduzieren. Ebenso sind die Ziele für nachhaltige Flugkraftstoffe und die Reduktion des Treibhausgasanteils der Schiffe erheblich, mit ambitionierten Zielen bis 2050. Seit teilweise sind auch die fortgeschrittenen Biokraftstoffe vorwiegend im Fokus, um die CO2-Bilanz weiter zu verbessern, da diese im Jahr 2030 mindestens 2,2 % des Verkehrssektors ausmachen sollen.
Der Nutzen von Biokraftstoffen im Verkehr
Biokraftstoffe spielen eine bedeutende Rolle im modernen Verkehrssystem und bieten zahlreiche Vorteile. Einer der wichtigsten Aspekte ist die Reduktion der Treibhausgasemissionen. Mit dem Ziel der Klimaneutralität tragen Biokraftstoffe entscheidend zur Treibhausgasreduktion bei, indem sie den CO2-Ausstoß im Verkehrssektor verringern. Darüber hinaus verringern sie die Abhängigkeit von fossilen Brennstoffen, wodurch die nachhaltige Mobilität gefördert wird.
Reduktion von Treibhausgasemissionen
Im Jahr 2023 konnten durch den Einsatz von Biokraftstoffen in Deutschland beeindruckende 12 Millionen Tonnen an CO2 eingespart werden. Die Treibhausminderungsquote wurde dabei mit einer Minderung von 11 Prozent deutlich übererfüllt, verglichen mit dem gesetzlichen Ziel von 8 Prozent. Diese Erfolge verdeutlichen die wichtige Rolle von Biokraftstoffen bei der Einsparung von Treibhausgasemissionen und der Erreichung von Klimazielen.

Reduzierung der Abhängigkeit von fossilen Brennstoffen
Die Nutzung von Biokraftstoffen hilft erheblich dabei, die Abhängigkeit von fossilen Brennstoffen zu reduzieren. Dies ist besonders wichtig, da es die Notwendigkeit für Ölimporte minimiert und somit die Energieversorgungssicherheit erhöht. Deutschland ist ein führender Lieferant von Biodiesel in die USA, und der zunehmende Einsatz von Bioethanol zeigt den Wandel hin zu einer nachhaltigeren Mobilität. Zusätzlich unterstützt die verstärkte Produktion von heimischen Biokraftstoffen die lokale Wirtschaft und schafft Arbeitsplätze im landwirtschaftlichen Sektor.
Umweltauswirkungen von Biokraftstoffen
Die Diskussion über die Umweltauswirkungen von Biokraftstoffen ist vielschichtig. Einerseits tragen Biokraftstoffe zur Reduktion von Treibhausgasemissionen bei, andererseits gibt es erhebliche Bedenken hinsichtlich der ökologischen Folgen. Besonders der Anbau von Biomasse wirft Fragen zur Nachhaltigkeit und zum Einfluss auf die Artenvielfalt auf.
Anbaubiomasse und ihre ökologische Bilanz
Die Produktion von Biokraftstoffen der ersten Generation, die aus Nahrungsmittelpflanzen wie Mais, Zuckerrohr und Raps gewonnen werden, hat oft negative Umweltauswirkungen. Der hohe Flächenverbrauch zur Erzeugung dieser Biomasse führt zur Abholzung von Wäldern und anderen natürlichen Habitaten. Dies reduziert nicht nur die Artenvielfalt, sondern kann auch zur Bodendegradation und zur Wasserverunreinigung beitragen. Die Umstellung auf Biokraftstoffe der zweiten und dritten Generation, die aus landwirtschaftlichen Reststoffen und Algen produziert werden, könnte nachhaltigere Alternativen bieten, solange entsprechende Bedingungen erfüllt werden.

Flächenverbrauch und Artenvielfalt
Ein signifikanter Nachteil des großflächigen Anbaus von Biomasse ist der damit verbundene Flächenverbrauch. Dieser vermindert die Artenvielfalt und zerstört natürliche Lebensräume. Studien haben gezeigt, dass der Anbau von Monokulturen, wie es oft bei Pflanzen für Biokraftstoffe der ersten Generation der Fall ist, negative Auswirkungen auf die Biodiversität hat. Diese Umweltauswirkungen können durch die Einführung von Zwischenfrüchten und einer diversifizierten Landwirtschaft gemindert werden. Zusätzlich fördern politisch unterstützte Maßnahmen, wie die Biokraftstoff-Nachhaltigkeitsverordnung in Deutschland, eine CO2-Reduktion von 50 bis 65 Prozent gegenüber fossilen Brennstoffen, was den positiven Einfluss von Biokraftstoffen auf die Umwelt verdeutlicht.
Bioethanol und Biodiesel: Vergleich und Einsatzgebiete
Bioethanol und Biodiesel sind zwei der bekanntesten Biokraftstoffe, die weltweit eingesetzt werden. Sie unterscheiden sich nicht nur in ihren Produktionsverfahren, sondern auch in ihren Effizienz- und Umweltaspekten.
Herstellungsverfahren und Effizienz
Bioethanol wird hauptsächlich aus zucker- und stärkehaltigen Pflanzen wie Mais und Zuckerrohr gewonnen. Das Produktionsverfahren Biodiesel hingegen wird aus Ölpflanzen wie Raps und Soja erzeugt. Das Verfahren beinhaltet die Umesterung von Pflanzenölen, um Fettsäuremethylester (FAME) zu erstellen.
Biodiesel hingegen wird aus Ölpflanzen wie Raps und Soja erzeugt. Das Verfahren beinhaltet die Umesterung von Pflanzenölen, um Fettsäuremethylester (FAME) zu erstellen.
Vor- und Nachteile von Bioethanol und Biodiesel
Bioethanol wird oft als Benzinersatz genutzt, während Biodiesel in Dieselantrieben zum Einsatz kommt. Der Vorteil von Biodiesel ist seine höhere Energiedichte und Effizienz bei der Verbrennung, was zu einer besseren Motorleistung und einem geringeren Kraftstoffverbrauch führt. HVO-Biodiesel kann beispielsweise in verschiedenen Motoren genutzt werden und reduziert CO2-Emissionen um bis zu 90 % im Vergleich zu herkömmlichem Diesel.
Andererseits hat Bioethanol eine geringere Energiedichte als fossiles Benzin, kann jedoch in hoher Reinheit (Super E10 enthält 10 % Ethanol) verwendet werden, um die CO2-Belastung zu senken. Allerdings kann die Nutzung von Nahrungsquellen für die Bioethanolproduktion zu Lebensmittelknappheit und Preissteigerungen führen.
Beide Biokraftstoffe zeigen vielversprechende Umwelteigenschaften, wie geringere Emissionen im Vergleich zu fossilen Brennstoffen. Doch während Biodiesel aus Ölpflanzen hergestellt wird und in viele bestehende Diesel-Infrastrukturen eingebunden werden kann, stellt die eingeschränkte Verfügbarkeit von Ausgangsstoffen und spezielle Motoranpassungen eine Herausforderung dar.
Kontroverse um die Nutzung von Nahrungsmitteln für Biokraftstoffe
Der Einsatz von Nahrungsmitteln wie Mais und Zuckerrohr für die Produktion von Biokraftstoffen führt zu kontroversen Diskussionen über die ethische Vertretbarkeit. Eine zentrale Frage dabei ist, inwiefern diese Praxis die Lebensmittelpreise beeinflusst und zur Nahrungsmittelknappheit beiträgt. Diese komplexe Thematik hat nicht nur weitreichende politische Debatten verursacht, sondern auch das Bewusstsein für die Nahrungsmittelkonkurrenz geschärft.

Koalitionsstreit und politische Perspektiven
Der Koalitionsstreit in Deutschland spiegelt die unterschiedlichen politischen Perspektiven wieder. Landwirtschaftsminister fordern eine stärkere Förderung von Biokraftstoffen, um die Abhängigkeit von fossilen Brennstoffen zu reduzieren. Dabei argumentieren sie, dass die Nutzung von 461,000 Hektar Agrarfläche für Agrarkraftstoffe gerechtfertigt ist. Auf der anderen Seite warnen Kritiker vor steigenden Lebensmittelpreisen und möglichen Engpässen in der Nahrungsmittelversorgung, was zu intensiven politischen Debatten führt.
Greenpeace-Proteste und deren Einfluss
Umweltschutzorganisationen wie Greenpeace haben wiederholt gegen die Nutzung von Nahrungsmitteln zur Biokraftstoffproduktion protestiert. Sie argumentieren, dass der Flächenverbrauch und die Monokulturen negative Auswirkungen auf die Artenvielfalt haben. Die Proteste haben nicht nur erheblichen Einfluss auf die öffentliche Meinungsbildung, sondern auch auf politische Entscheidungen. Diese Meinungsverschiedenheiten verdeutlichen die Problematik der Nahrungsmittelkonkurrenz und deren Auswirkungen auf die Lebensmittelpreise.
Palmöl und seine Rolle in Biokraftstoffen
Palmöl spielt eine zentrale Rolle als eine der Hauptquellen für die Herstellung von Biokraftstoffen in Europa. In den vergangenen Jahren landeten Milliarden Liter importiertes Palmöl in Auto- und Lkw-Tanks für die Produktion von Biokraftstoffen. Der Wert von Palmöl als Rohstoff für Biodiesel resultiert aus seiner relativ günstigen Verfügbarkeit und starken Produktionskapazitäten in Ländern wie Indonesien und Malaysia. Diese zwei Länder machten 2020 zusammen 84,1% der Weltproduktion aus und sind die Hauptlieferanten von Palmöl weltweit. Indonesien hatte 2020 einen Marktanteil von 59%, während Malaysia einen Marktanteil von 25,2% hatte.

Umweltauswirkungen des Palmölanbaus
Die Umweltbelastung durch den Anbau von Palmöl ist erheblich. Der Palmölanbau führt oft zu gravierenden ökologischen Schäden wie der Abholzung von Regenwäldern, was den Verlust von Artenvielfalt und die Freisetzung großer Mengen von Treibhausgasemissionen nach sich zieht. Tatsächlich wurde festgestellt, dass Biodiesel aus Palmöl dreimal schädlicher für das Klima ist als fossiler Diesel aus Erdöl. Der Anbau von Palmöl beansprucht zudem wertvolle Flächen und führt zu einer beträchtlichen Umweltbelastung in den betroffenen Regionen.
Alternativen zu Palmöl
Um die Umweltbelastung zu reduzieren, werden zunehmend nachhaltige Alternativen zum Einsatz von Palmöl in der Biokraftstoffproduktion erforscht. Dazu gehören biobasierte Rohstoffe wie Algen, gebrauchtes Speiseöl oder tierische Fette. Die Europäische Union fördert die Entwicklung von Biokraftstoffen aus Stroh, gebrauchtem Öl, Fetten und tierischen Abfällen, um traditionelle Quellen wie Mais und Palmöl zu ersetzen. Frankreich hat sich bereits entschieden, Palmöl bis 2020 aus Biokraftstoffen zu verbannen, während Deutschland plant, diesen Schritt bis 2023 zu vollziehen.
Fortschritte und Innovationen in der Biokraftstofftechnologie
Die Welt der Biokraftstoffe hat in den letzten Jahren bemerkenswerte technologische Fortschritte erlebt. Die Forschung konzentriert sich stark auf die Entwicklung neuer Methoden und Alternativen, um die Umweltbelastung zu minimieren und die Effizienz der Kraftstoffproduktion zu steigern.
Biokraftstoffe der zweiten Generation
Zweite Generation Biokraftstoffe bieten signifikante Vorteile gegenüber herkömmlichen Biokraftstoffen, indem sie nicht essbare Pflanzenteile oder Abfallprodukte nutzen. Diese nachhaltigen Lösungen verringern die Konkurrenz um Nahrungsmittelressourcen und tragen zur Reduzierung der Treibhausgasemissionen bei.
Ein besonderes Beispiel ist Zellulose-Ethanol, das aus nicht essbaren Rohstoffen hergestellt wird und somit eine sehr nachhaltige Biomasseressource darstellt. In Brasilien hat die Produktion von Ethanol auf Zuckerrohrbasis erheblich zur Biokraftstoffindustrie beigetragen, was zu einer signifikanten Reduzierung der Treibhausgasemissionen geführt hat.
Neue Technologien und Forschung in der Biokraftstoffproduktion
Die biokraftstoffbezogene Forschung erforscht kontinuierlich neue Technologien und Methoden zur Herstellung von Biokraftstoffen. Die hydrothermale Verflüssigung hat das Potenzial, erneuerbare Rohölersatzstoffe aus einer Vielzahl von Rohstoffen zu produzieren. Diese Methode könnte sich als bahnbrechend für die Energieindustrie erweisen.
Auch die Nutzung von Algen als Energiequelle wird intensiv untersucht. Algen bieten eine hohe Umwandlungseffizienz und können große Mengen an Biokraftstoff liefern, ohne Ackerland zu beanspruchen. Technologischer Fortschritt, wie die Nutzung der Consolidated Bioprocessing (CBP)-Technologie, treibt das Marktwachstum für flüssige Biokraftstoffe zusätzlich voran.
Zusammenfassend lässt sich sagen, dass Zweite Generation Biokraftstoffe und die damit verbundenen technologische Fortschritte das Potenzial haben, die Energieversorgung nachhaltiger zu gestalten und gleichzeitig die Umwelt zu schonen.
Biokraftstoffpolitik in Deutschland
Die Biokraftstoffpolitik in Deutschland umfasst eine Reihe von gesetzlichen Rahmenbedingungen und Quoten, die den Einsatz und die Förderung von Biokraftstoffen regeln. Biokraftstoffe wie Biodiesel, Bioethanol und Biomethan spielen eine entscheidende Rolle bei der Reduktion von Treibhausgasemissionen und der Diversifizierung der Energiequellen im Verkehrssektor.
Gesetzliche Rahmenbedingungen und Quoten
Die Gesetzgebung in Deutschland hat einige Instrumente implementiert, um den Einsatz von Biokraftstoffen zu fördern. Eine zentrale Rolle spielt dabei die THG-Quote, die die Inverkehrbringer von Kraftstoffen verpflichtet, die CO2-Emissionen ihrer Produkte zu senken. Die THG-Quote wurde zuletzt im Jahr 2021 fortentwickelt und ist im Bundes-Immissionsschutzgesetz sowie weiteren untergesetzlichen Normen verankert. Durch die THG-Quote sollen bis 2030 25 Prozent der Emissionen der Kraftstoffabsatzmenge reduziert werden, was im Einklang mit dem Klimaschutzgesetz zu einem Gesamtziel von 83,7 Millionen Tonnen CO2-Äquivalent führt.
Biokraftstoffe sparen in Deutschland jährlich rund 10,5 Millionen Tonnen CO2-Äquivalent ein und stellen rund 82 Prozent des Anteils erneuerbarer Energien im Verkehrssektor. Die Produktion von Biokraftstoffen erzeugt zudem jährlich wirtschaftliche Impulse in Höhe von mehr als 5 Milliarden Euro.
Aktuelle politische Debatten
Im politischen Diskurs stehen derzeit die Anpassungen der gesetzlichen Vorgaben, um die klimapolitischen Ziele zu erreichen, im Mittelpunkt. Eine zentrale Diskussion betrifft die Novellierung der RED II (Renewable Energy Directive), deren indikatives Ziel für Erneuerbare Energien im Verkehr bis 2030 auf 29 Prozent mehr als verdoppelt wurde. Außerdem wird debattiert, inwiefern Maßnahmen zur Betrugsprävention bei der Biokraftstoffzertifizierung verstärkt werden müssen, um die Verlässlichkeit der Nachhaltigkeitszertifizierung sicherzustellen.
Ein weiterer Diskussionspunkt ist der Import von vermeintlich fortschrittlichem Biodiesel aus China, der möglicherweise fälschlicherweise als Palmöl-Biodiesel etikettiert ist. Seit 2023 kann dieser nicht mehr zur Erfüllung der deutschen Treibhausgasminderungsquote angerechnet werden, was das Vertrauen in die Biokraftstoffpolitik nachhaltig beeinflusst.
Nachhaltigkeitsaspekte von Biokraftstoffen
Die Nachhaltigkeit von Biokraftstoffen ist ein zentrales Anliegen, da sie maßgeblich zur Reduktion von Umweltauswirkungen beitragen sollen. Die Europäische Kommission hat den deutschen Antrag auf Anerkennung der Berechnung typischer Treibhausgasemissionen aus dem Anbau landwirtschaftlicher Rohstoffe positiv bewertet, was ein wichtiger Schritt in Richtung ökologischer Verantwortung ist.
Nachhaltigkeitszertifikate und Kriterien
Nachhaltigkeitszertifikate wie RED II sind entscheidend, um sicherzustellen, dass Biokraftstoffe tatsächlich zu einer Reduktion von Umweltauswirkungen beitragen. Deutschland hat neue NUTS2-Werte zur Anerkennung für den Anbau von landwirtschaftlichen Rohstoffen gemäß RED II vorgelegt. Diese Zertifikate stellen auch sicher, dass die neuen Vorschriften von den EU-Mitgliedstaaten bis zum 30. Juni 2021 umgesetzt und ihre Systemvorgaben angepasst wurden.
Im Jahr 2023 teilte die Europäische Kommission mit, dass die bisherigen NUTS2-Werte, die unter RED I entwickelt und anerkannt wurden, nicht mehr gültig sind, und Deutschland ersetzte die Biokraftstoff-Nachhaltigkeitsverordnung und die Biomassestrom-Nachhaltigkeitsverordnung durch aktualisierte Versionen ab 08. Dezember 2021. Die ersten freiwilligen Systeme zur Zertifizierung der Nachhaltigkeit und der Treibhausgaseinsparungen von Biokraftstoffen wurden im Rahmen der RED II von der Europäischen Kommission anerkannt.
Vergleich mit anderen erneuerbaren Energien
Biokraftstoffe werden kontinuierlich im Vergleich zu anderen erneuerbaren Energien evaluiert. Während erneuerbare Energien wie Wind- und Solarenergie zur Reduktion der Treibhausgasemissionen beitragen, spielt auch der Verkehrssektor eine bedeutende Rolle. Der Verkehrssektor trägt insgesamt zu etwa einem Fünftel der gesamten Treibhausgasemissionen Deutschlands bei, wobei der Straßengüterverkehr durch Lkw einen Anteil von etwa 35 % an diesen Emissionen hat.
Algenbasierte Biokraftstoffe beispielsweise können auf kurz- und mittelfristige Sicht keinen spürbaren Beitrag für einen klimaneutralen Verkehr leisten. Wissenschaftlich-technische Durchbrüche und Prozessinnovationen sind erforderlich, um die Treibhausgasbilanz des Straßengüterverkehrs durch algenbasierte Biokraftstoffe bis 2050 signifikant zu verbessern. Dennoch zeigen Studien, dass die Produktionskosten der Algenbiomasse je nach Produktionssystem zwischen 500 und 100.000 Euro pro Tonne liegen, was die wirtschaftliche Effizienz dieser erneuerbaren Energie im Vergleich zu traditionellen Biokraftstoffen wie Raps und Weizen stark beeinflusst.
Durch fundierte Zertifikate und die kontinuierliche Bewertung im Vergleich zu anderen erneuerbaren Energien kann die Nachhaltigkeit von Biokraftstoffen kontinuierlich verbessert werden.
Biokraftstoffe: Zukunftsperspektiven und globale Einflüsse
Die Zukunft der Biokraftstoffe wird maßgeblich durch globale Trends, technologische Innovationen und Veränderungen in der erneuerbaren Energiepolitik geprägt. Ein bedeutender Einflussfaktor ist die Entwicklung der grünen Chemie, die in den 1990er Jahren ihren Anfang nahm. Durch die Einführung der 12 Prinzipien der grünen Chemie durch Paul Anastas und John Warner im Jahr 1998 wurden große Fortschritte in der Nutzung natürlicher Ressourcen und der Minimierung von Umweltauswirkungen erzielt.
Ein bemerkenswertes Beispiel dafür sind biobasierte Chemikalien wie Polylactid (PLA) und Polyhydroxyalkanoate (PHA), die nachhaltige Alternativen zu herkömmlichen fossilen Rohstoffen darstellen. Technologische Projekte wie „Grundlagenuntersuchungen zu neuen Hochleistungsverbunden aus Naturfasern und Guss-Polyamid“ (Projektcode: 22005113, Laufzeit: 2015-08-01 bis 2018-02-28) und „Holzbasierte Hybridnanokomposite als multifunktionale Hochleistungsausgangsmaterialien für den 3D-Druck“ (Projektcode: 22004518, Laufzeit: 2016-06-01 bis 2020-02-29) zeigen, wie innovativere Ansätze zur Herstellung langlebiger und nachhaltiger Materialien durchgesetzt werden.
Ein weiterer wesentlicher Aspekt sind die katalytischen Verfahren, die effizienzsteigernd wirken, den Energieverbrauch reduzieren und Abfälle minimieren können. Beispielsweise erleichtern superkritische CO2-Lösungsmittel umweltfreundliche chemische Prozesse und setzen neue Maßstäbe in der nachhaltigen Chemie. Projekte wie „Entwicklung eines biobasierten hochkratzfesten Autoklarlacks auf der Basis von rekonfigurierbarem Cyclodextrin“ (Laufzeit: 2016-06-01 bis 2020-12-31) zeigen, wie wichtig Innovationen für die Erreichung der Klimaneutralitätsziele sind.
Indessen weisen weltweit bestehende Marktveränderungen darauf hin, dass nachhaltige Technologien eine tragende Säule für die Energiepolitik der Zukunft werden. Die nachhaltige Chemie ist somit ein integraler Bestandteil grüner Technologien und fördert die Umsetzung nachhaltiger und umweltfreundlicher Ansätze. Aus diesen Gründen bleibt die kontinuierliche Forschung und Entwicklung in diesem Bereich unerlässlich, um eine kostengünstigere und ökologischere Form der Energie proaktiv in unser Energieportfolio zu integrieren und damit die Klimaziele effizient zu erreichen.