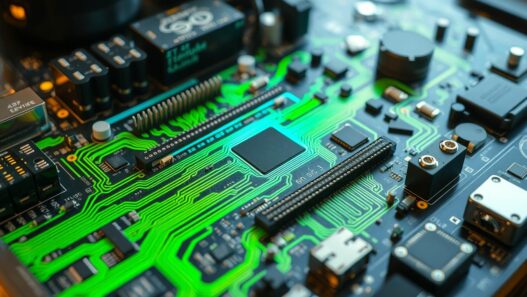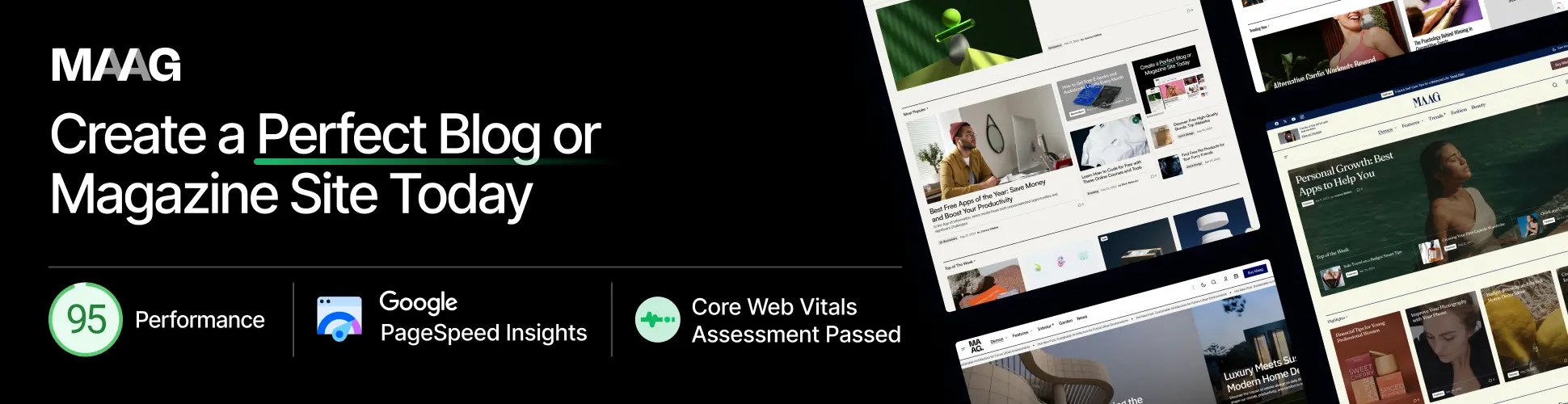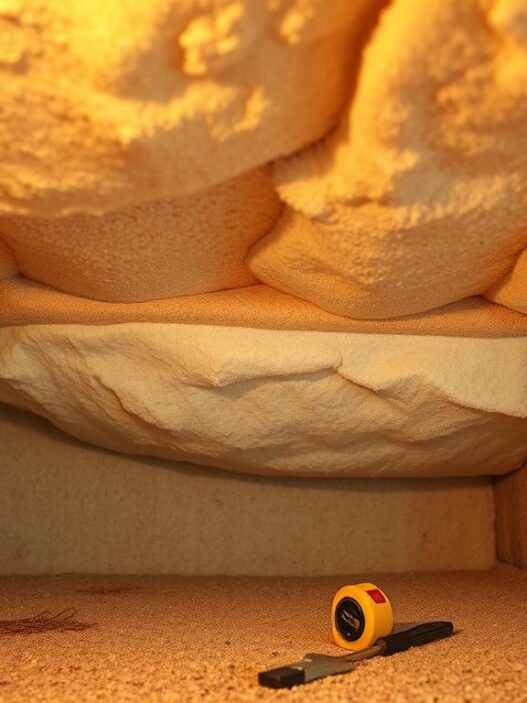Wie kann Deutschland seine Rohstoffversorgung für Schlüsseltechnologien wie Elektromobilität und erneuerbare Energien sicherstellen? Eine zentrale Herausforderung ist der steigende Bedarf an Kobalt, einem essenziellen Rohstoff für Lithium-Ionen-Batterien. Könnte der heimische Bergbau einen Beitrag zur Deckung dieses Bedarfs leisten?
Zentrale Erkenntnisse:
- Deutschland plant die Stärkung der heimischen Rohstoffförderung und -verarbeitung
- Kobalt ist ein kritischer Rohstoff mit steigender Nachfrage durch E-Mobilität und Erneuerbare
- Sachsen verfügt über vielversprechende Erkundungsvorhaben für den Bergbau von Erzen und Spaten
- Potenzial zur Deckung von Lithiumbedarf durch Geothermie-Kraftwerke in Deutschland
- Umweltaspekte und Nachhaltigkeit sind zentrale Diskussionsthemen
Aktueller Stand des Kobalt Abbau Deutschland
Der Abbau von Kobalt in Deutschland gewinnt zunehmend an Bedeutung für die deutsche Industrie. In Sachsen laufen derzeit 28 Erkundungsvorhaben für verschiedene Rohstoffe, darunter auch Kobalt. Fünf dieser Vorhaben zum Abbau von Erzen und Spaten sind bereits weit fortgeschritten. Im Erzgebirge plant das Projekt Tellerhäuser die Förderung von 3.000 Tonnen Zinn pro Jahr, wobei auch andere Metalle wie Kobalt als Nebenprodukt gewonnen werden könnten.
Bedeutung für die deutsche Industrie
Kobalt ist ein wichtiger Rohstoff für die deutsche Industrie, insbesondere für die Herstellung von Lithium-Ionen-Batterien, die in Elektrofahrzeugen und elektronischen Geräten eingesetzt werden. Die Nachfrage nach Kobalt steigt stetig, sodass der Abbau in Deutschland an Relevanz gewinnt.
Hauptabbaugebiete und Vorkommen
Neben den Erkundungsvorhaben in Sachsen gibt es auch Aktivitäten in anderen Bundesländern. In Rheinland-Pfalz und Baden-Württemberg wird die Gewinnung von Lithium aus Geothermie-Anlagen erforscht, was auch für die Kobaltgewinnung relevant sein könnte. Die genauen Vorkommen und Abbaugebiete in Deutschland sind jedoch noch nicht vollständig erforscht und dokumentiert.
Aktuelle Fördermenge und Statistiken
Die derzeitige Fördermenge von Kobalt in Deutschland ist im Vergleich zur weltweiten Produktion noch gering. Laut Schätzungen der Bundesanstalt für Geowissenschaften und Rohstoffe (BGR) könnte bis 2030 eine Lücke zwischen Förderung und Nachfrage von Kobalt in Höhe von bis zu 300.000 Tonnen pro Jahr bestehen. Die Entwicklung des Kobaltabbaus in Deutschland wird daher in Zukunft von großer Bedeutung sein.

Geschichte des Kobaltbergbaus in Deutschland
Der Kobaltbergbau in Deutschland hat eine lange und faszinierende Geschichte, die bis in das 12. Jahrhundert zurückreicht. Das Erzgebirge und der Harz, zwei der historischen Bergbauregionen Deutschlands, waren einst Zentren der Kobaltgewinnung. In den Anfangsjahren des Bergbaus wurde Kobalt jedoch oft zusammen mit anderen wertvollen Erzen wie Silber, Kupfer und Zinn gefördert, ohne dass seine Bedeutung als eigenständiges Metall erkannt wurde.
Erst im 16. Jahrhundert begann die gezielte Förderung von Kobalt, vor allem im sächsischen Teil des Erzgebirges. Hier wurden neue Lagerstätten erschlossen und die Produktion von Kobaltsmalte, einem blauen Farbstoff, expandierte. Der Erzgebirgsraum wurde zum weltweit führenden Kobaltlieferanten und behauptete diese Stellung bis ins 19. Jahrhundert hinein.
„Sachsen deckte in der DDR mit einer Produktion von 2.500 Tonnen Zinn pro Jahr komplett den Bedarf.“
Neben dem Erzgebirge spielte auch das Siegerland im westlichen Teil Deutschlands eine wichtige Rolle im Kobaltbergbau. Hier nahmen die Aktivitäten ab 1780 deutlich zu, mit zeitweise bis zu 50 neuen Förderstätten pro Monat. Allerdings führte der Preisverfall des Kobalts Ende des 18. Jahrhunderts zum Zusammenbruch dieses Marktes.
Die Geschichte des Kobaltabbaus in Deutschland ist geprägt von technischen Innovationen, wirtschaftlichen Höhen und Tiefen sowie der Bedeutung des Metalls für die Industrieentwicklung. Auch heute, mehr als 200 Jahre später, gewinnt der Kobaltabbau in Deutschland wieder an Relevanz, da das Metall für moderne Technologien von strategischer Wichtigkeit ist.

Kobaltgewinnung aus Bergbaurückständen im Harz
In den Bergbauregionen des Harzes forschen Wissenschaftler an innovativen Methoden, um Kobalt aus bestehenden Bergbaurückständen zu gewinnen. Am Bergeteich Bollrich bei Goslar lagern rund 1.220 Tonnen Kobalt, die durch neue Recyclingverfahren genutzt werden könnten.
Innovative Recyclingmethoden
Die Bundesanstalt für Geowissenschaften und Rohstoffe hat im Labor mithilfe des Biolaugungs-Verfahrens bis zu 91% des in den Rückständen enthaltenen Kobalts extrahieren können. Dabei kommen speziell angepasste azidophile Laugungs-Bakterien zum Einsatz, die das Kobalt aus dem Feststoff lösen. Bei der Forschung entdeckten die Wissenschaftler sogar ein neues Bakterium, das sie Sulfobacillus harzensis nannten.
Biolauging-Verfahren zur Kobaltextraktion
Das Biolaugungs-Verfahren bietet große Potenziale für die Gewinnung von Kobalt aus Bergbaurückständen. Im Vergleich zu herkömmlichen Methoden ist es deutlich umweltfreundlicher und ressourcenschonender. Die Kobaltextraktion aus den Harz-Rückständen könnte einen wichtigen Beitrag zur deutschen kobaltproduktion deutschland leisten und die Abhängigkeit von Importen reduzieren.
Projekt Bollrich bei Goslar
Im Rahmen des Projekts „Bollrich“ bei Goslar soll die Machbarkeit der Kobaltgewinnung aus den dortigen Bergbaurückständen weiter untersucht werden. Die Forschungsergebnisse könnten neue Impulse für den Auf- und Ausbau der deutsche kobaltindustrie setzen und die Versorgung mit diesem wichtigen Industrierohstoff in Deutschland verbessern.

Nachhaltige Rohstoffgewinnung und Umweltaspekte
Die Förderung von Rohstoffen wie Kobalt in Deutschland unterliegt strengen Umwelt- und Sozialstandards. Dennoch gibt es bei Bürgerinitiativen, insbesondere im Erzgebirge und im Oberrheingraben, Bedenken hinsichtlich möglicher Lärmbelastung, Vibrationen, Grundwasserabsenkung und seismischer Aktivitäten. Experten betonen, dass es keinen vollständig nachhaltigen Bergbau gibt, aber in Deutschland die höchsten Standards umgesetzt werden.
Laut Studien arbeiten weltweit mehr als 20 Millionen Menschen direkt im Bergbau, wobei viele als kleine Schürfer ohne jeglichen Schutz tätig sind. Erschreckenderweise sind sogar 1 bis 1,5 Millionen Kinder in diesem Bereich beschäftigt. Insgesamt hängen über 100 Millionen Menschen vom Bergbau ab, doch profitieren in vielen Ländern nur wenige von den Einnahmen.
Deutschland importiert rund 80 Prozent der benötigten Rohmetalle, die dann als veredelte Endprodukte exportiert werden. Das zeigt die Abhängigkeit der deutschen Industrie von Rohstoffimporten. In manchen Ländern wie der Republik Kongo, die über reiche Kobaltvorräte verfügt, führt der Rohstoffabbau zu sozialen Missständen, Umwelt- und Gesundheitsschäden.
„Die Menschen in den Industrieländern verbrauchen vier Fünftel der globalen Rohstoffe, obwohl sie nur ein Fünftel der Weltbevölkerung ausmachen.“
Das Umweltbundesamt (UBA) empfiehlt daher ein System verbindlicher menschenrechtlicher, ökologischer und sozialer Sorgfaltspflichten entlang der gesamten Rohstofflieferkette. Zudem sollen Demonstrationsvorhaben zur inländischen primären Rohstoffgewinnung von Metallerzen wie Kobalt gefördert werden, um die Abhängigkeit von Importen zu reduzieren und die Nachhaltigkeit zu erhöhen.

Deutsche Kobaltindustrie im internationalen Vergleich
Deutschland steht bei der Kobaltförderung und -verarbeitung vor besonderen Herausforderungen. Als rohstoffarmes Land ist die Bundesrepublik bei vielen wichtigen Rohstoffen, darunter auch kobaltförderung in deutschland, stark vom Ausland abhängig. Mit dem „Critical Raw Materials Act“ versucht die Europäische Union jedoch, diese Importabhängigkeit zu reduzieren und die deutsche kobaltindustrie wettbewerbsfähiger zu machen.
Wettbewerbsfähigkeit deutscher Standorte
Im Vergleich zu anderen Ländern, insbesondere China, schneiden die deutschen Anbieter in Studien zur Einhaltung von Umwelt-, Sozial- und Menschenrechtsstandards relativ gut ab. Allerdings ist die Kobaltförderung in Deutschland aufgrund der fehlenden Primärvorkommen deutlich geringer als in Ländern wie der Demokratischen Republik Kongo, die über 60 Prozent der weltweiten Produktion stellen.
Importabhängigkeit und Handelbeziehungen
Um die Importabhängigkeit bei kobaltförderung in deutschland zu reduzieren, setzt die EU verstärkt auf den Aufbau von Partnerschaften mit rohstoffreichen Ländern. Dabei achtet man besonders auf die Einhaltung von Nachhaltigkeitsstandards entlang der gesamten Lieferkette. Im Gegensatz zu China verspricht die EU, Wertschöpfungsketten vor Ort zu stärken und so zum Wohlstand der Partnerländer beizutragen.

„Verbindliche Gesetze zu menschenrechtlichen und umweltbezogenen Sorgfaltspflichten sind unerlässlich, um die deutsche kobaltindustrie zukunftsfähig aufzustellen.“
Amnesty International betont die Wichtigkeit solcher Regulierungen, um Menschenrechtsverletzungen und Umweltschäden in den Rohstofflieferketten zu verhindern. Nur so kann die deutsche Kobaltindustrie langfristig im internationalen Wettbewerb bestehen.
Technologische Innovationen im Kobaltbergbau
Die Kobaltgewinnung in Deutschland profitiert zunehmend von innovativen Technologien. Eine vielversprechende Methode ist das sogenannte Biolauging-Verfahren, bei dem spezielle Bakterien eingesetzt werden, um Kobalt aus Bergbaurückständen zu extrahieren. Im Harz wurde beispielsweise das Bakterium Sulfobacillus harzensis entdeckt, das bei dieser Kobaltgewinnung eine wichtige Rolle spielen könnte.
Auch im Erzgebirge laufen Projekte zur Rückgewinnung von Metallen aus Bergbauabfällen. Neben Kobalt stehen hier Zink, Blei, Kupfer und Indium im Fokus. Diese Technologien zur nachhaltigen Kobaltproduktion in Deutschland sind ein wichtiger Schritt, um die Importabhängigkeit von Rohstoffen zu verringern und die heimische Kobaltgewinnung auszubauen.
„Die Nutzung der innovativen Biolauging-Methode eröffnet neue Möglichkeiten, um Kobalt aus Altlasten des Bergbaus zu gewinnen und so die Kobaltproduktion in Deutschland zu steigern.“
Darüber hinaus treiben Unternehmen wie Freeport Cobalt, Glencore und Umicore die technologische Entwicklung in der deutschen Kobaltindustrie voran. Mit ihren Investitionen in Forschung und Entwicklung tragen sie dazu bei, die Wettbewerbsfähigkeit der kobaltgewinnung deutschland und kobaltproduktion deutschland weiter zu stärken.

Wirtschaftliche Bedeutung der Kobaltförderung
Die Wiederbelebung des Bergbaus in Deutschland, einschließlich der Förderung von Kobalt, verspricht die Schaffung neuer Arbeitsplätze und wirtschaftliche Impulse für die betroffenen Regionen. Das Zinnbergwerksprojekt Tellerhäuser im Erzgebirge plant beispielsweise die Schaffung von über 100 Arbeitsplätzen. Die Verarbeitung von Rohstoffen wie Kobalt in Deutschland, wie die geplante Lithiumraffinerie in Guben, trägt zur Stärkung der lokalen Wertschöpfungskette bei.
Arbeitsplätze und regionale Entwicklung
Der Abbau und die Verarbeitung von kobalthaltigem Material in Deutschland haben das Potenzial, neue Beschäftigungsmöglichkeiten in den Bergbauregionen zu schaffen. Projekte wie das Zinnbergwerk Tellerhäuser im Erzgebirge zeigen, dass der Bergbau auch in Zukunft ein wichtiger Wirtschaftsfaktor für strukturschwache Regionen sein kann. Die Ansiedlung von Industriebetrieben zur Weiterverarbeitung von Kobalt, wie die geplante Lithiumraffinerie, kann zusätzliche Arbeitsplätze und Wertschöpfung in den betroffenen Regionen generieren.
Wertschöpfungskette und Verarbeitung
Die Förderung und Verarbeitung von Kobalt in Deutschland können zur Stärkung der heimischen Wertschöpfungskette beitragen. Anstatt den Rohstoff lediglich zu exportieren, bietet sich die Möglichkeit, Kobalt in Deutschland weiter zu veredeln und in der Industrie einzusetzen. Dies stärkt nicht nur die Wettbewerbsfähigkeit deutscher Unternehmen, sondern reduziert auch die Abhängigkeit von Importen. Innovative Recyclingmethoden und Biolauging-Verfahren zur Kobaltextraktion können zusätzlich dazu beitragen, die Versorgung mit diesem kritischen Rohstoff in Deutschland und Europa zu verbessern.
Zukunftsperspektiven für den Kobaltabbau in Deutschland
Der zukünftige Kobaltabbau in Deutschland steht vor verschiedenen Herausforderungen, bietet aber auch vielversprechende Möglichkeiten. Technologische Innovationen wie das Biolauging-Verfahren zur umweltfreundlichen Kobaltextraktion aus Bergbaurückständen eröffnen neue Perspektiven. Gleichzeitig erfordert die Integration in die europäische Rohstoffstrategie und den Fokus auf Nachhaltigkeit und Kreislaufwirtschaft weitere Anstrengungen.
Angesichts der begrenzten heimischen Vorkommen und der starken Importabhängigkeit von Ländern wie der Demokratischen Republik Kongo und China wird die Versorgungssicherheit bei Kobalt eine zentrale Rolle spielen. Die Forschung an alternativen Materialien und Recyclingverfahren gewinnt daher zunehmend an Bedeutung, um die Abhängigkeit von Importen zu reduzieren.
Letztendlich hängt die Zukunft des Kobaltabbaus in Deutschland von einer Vielzahl von Faktoren ab – von der technologischen Entwicklung über die wirtschaftliche Machbarkeit bis hin zur gesellschaftlichen Akzeptanz. Nur wenn diese Aspekte sorgfältig abgestimmt werden, kann der Kobaltbergbau in Deutschland langfristig erfolgreich sein und einen Beitrag zur Versorgungssicherheit leisten.